Eribon über Eribon
Im Interviewband 'Sociobiographie' (2025) legt der französische Intellektuelle eine eigene Werkschau vor


Gregor Schuhen

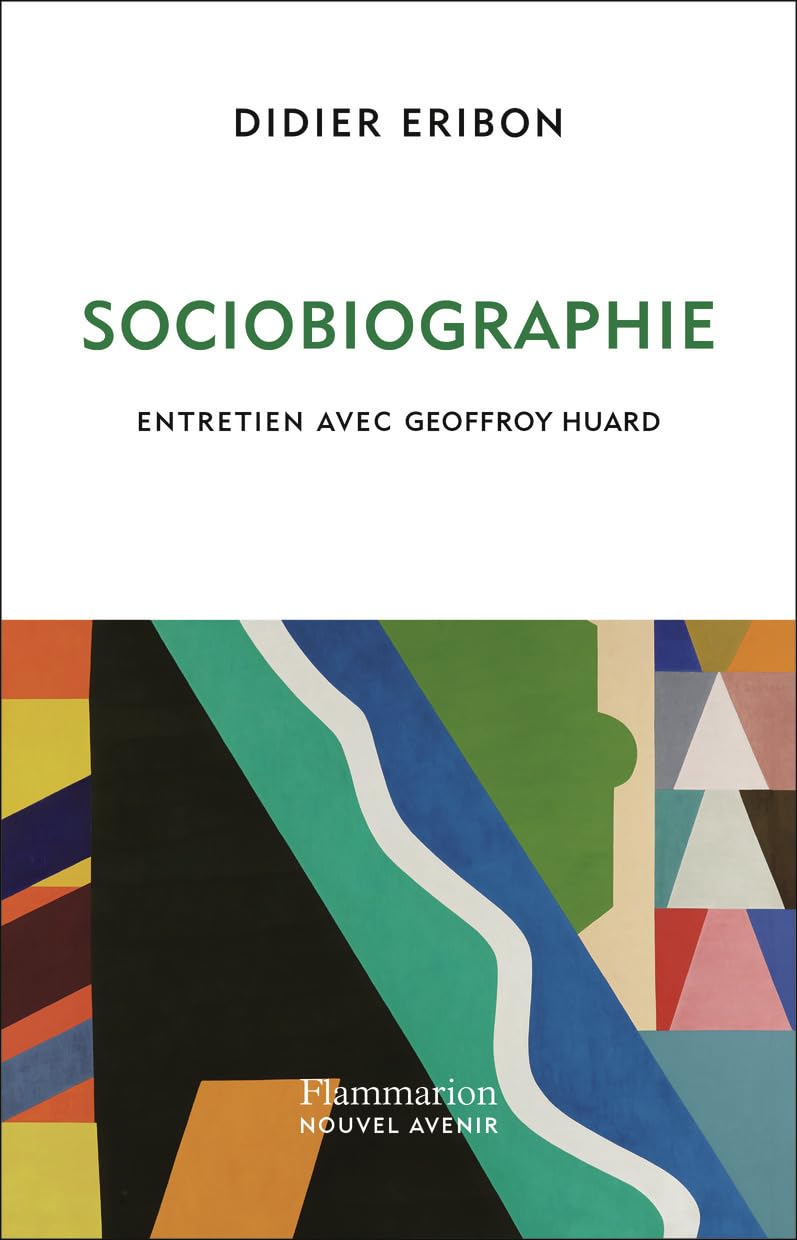
Auch wenn der Titel „Sociobiographie“ im Buch selbst mehrfach auftaucht und auch erläutert wird, bleibt er doch bis zur letzten Seite einigermaßen rätselhaft. Als Leser und Leserinnen von Didier Eribon, Annie Ernaux, Édouard Louis und anderen kennen wir inzwischen längst die Gattungsbezeichnung der Autosoziobiografie, jener Mischform aus Autobiografie und Sozialstudie, deren Name auf Ernaux zurückgeht und die sich seit einigen Jahren auch hierzulande größerer Beliebtheit erfreut. Eribon hat nun das „auto“ getilgt, also den deutlich markierten Bezug zum eigenen Erleben. Diese Änderung ist im vorliegenden Fall besonders irritierend, da es von der ersten bis zur letzten der rund 330 Seiten eigentlich durchgehend nur um eines geht: um Eribon. Etwas präziser gewendet geht es jedoch weniger um einen Abriss von Eribons Lebensgeschichte als um seine Werkgeschichte. In chronologischer Abfolge wird Eribon zu sämtlichen seiner größeren Veröffentlichungen interviewt, also angefangen von seinen Gesprächen mit Georges Dumézil (1987) über die Foucault-Biografie (1989) und Reflexions sur la question gay (1998) bis zu Retour à Reims (2009) und Vie, vieillesse et mort d’une femme du peuple (2023). Fragensteller ist Geoffroy Huard, Historiker und Spezialist für Queer Studies und jüngere spanische Geschichte an der Université Cergy. Cergy ist nicht nur der Wohnort von Annie Ernaux, sondern dort unterrichtet auch ein weiterer Geoffroy, namentlich Geoffroy de Lagasnerie, der Lebenspartner von Eribon. Im Vorwort spricht Huard ehrerbietig von der Erleuchtung („illumination“) und von der Leseleidenschaft, die ihm Eribons Texte stets beschert haben – man darf also nicht mit allzu kritischen Fragen rechnen.
Was dann folgt, sind einerseits die Fragen zu Eribons Werken, aber auch zu den jeweiligen Lebensphasen, aus denen die Texte hervorgegangen sind. Wir erfahren einiges über Eribons Anfänge als Journalist, über seine engen Beziehungen zu Foucault und Bourdieu, dann über seine Bewunderung für Sartre und über seine eigene Rolle als Pionier der französischen Queer Studies, die damals noch Gay and Lesbian Studies hießen. Einmal mehr bringt Eribon seine beinahe bedingungslose Abneigung der Psychoanalyse gegenüber zum Ausdruck: Freud und insbesondere Lacan hält er für homophobe Machos, ihre Schriften für spekulativ-unwissenschaftlich (Freud) oder unlesbar (Lacan). Auch Habermas kommt nicht gut weg: Er sei der Bestatter der Frankfurter Schule, vollkommen taub für gegenläufige Meinungen und mindestens konservativ, wenn nicht sogar rechts (S. 252). Bourdieu hingegen führt mit 87 Nennungen die Hitliste seiner Favourites an, man habe bis zu Bourdieus Tod jeden Tag miteinander telefoniert. Retour à Reims sei gewissermaßen Eribons Versuch gewesen, Bourdieus Soziologischen Selbstversuch (2002) zu veredeln, indem er – über Bourdieu hinausgehend – die Darstellung des eigenen Lebenswegs deutlich erweitert habe. Das war so ähnlich schon in La société comme verdict (2013) nachzulesen.
Interessant ist aber nicht nur, wer von Eribon auf die eine oder andere Weise namentlich gewürdigt wird. Nein, aufschlussreich ist auch, wer nicht erwähnt wird. Im gerade genannten La société comme verdict tauchte z.B. noch ein ganzes Kapitel über Annie Ernaux auf, in dem sich Eribon vor allem auf Une femme bezieht und daran anknüpfend über seine eigene Mutter und Großmutter nachdenkt sowie über das Verhältnis von Literatur und Politik im Allgemeinen. Man durfte also erwarten, dass Ernaux auch in Sociobiographie als wichtiges Vorbild auftauchen würde, zumal Eribon ausführlich über sein eigenes Stilideal Auskunft gibt (S. 198ff.), das dem von Ernaux beinahe bis in die Diktion gleicht. Nichts dergleichen. Der Name Ernaux wird nur ein einziges Mal genannt (S. 262) und dort auch nur innerhalb einer Aufzählung, in der ganz allgemein von Klassenliteratur die Rede ist. Auch Chantal Jaquet, die in Frankreich längst als Theoretikerin des Klassenübergangs gilt und den Begriff „transclasse“ geprägt hat, wird nicht ein einziges Mal genannt, ebenso wenig wie andere Vertreterinnen und Vertreter der Gattung Autosoziobiografie (außer natürlich Édouard Louis!). Das ist umso erstaunlicher, als Eribon mehrfach auf deutsche Autoren und Autorinnen wie Christian Baron oder Daniela Dröscher eingeht. Hier erhärtet sich ein Verdacht, den ich schon länger hege, nämlich dass Eribon gemeinsam mit Louis das Monopol für diese Gattung beansprucht, zumindest in Frankreich, wo es besonders zahlreiche Ableger gibt. Ernaux dürfte bei Eribon in Ungnade gefallen sein, als sie ihre Kollegin Rose-Marie Lagrave öffentlich gegen Eribon verteidigt hatte, da jener ihr vorgeworfen hatte, mit Se ressaisir (2021) ein verabscheuungswürdiges und homophobes Buch veröffentlicht zu haben (hier ein Bericht zu dieser Kontroverse). Eribon steckt also in Sociobiographie – nicht zuletzt auch mit dem Titel – einmal mehr das Feld der Klassenliteratur in Frankreich ab und markiert damit überdeutlich ‚sein‘ Revier. Er tut dies mit Lob- und Schmähreden auf bereits Verstorbene, aber vor allem auch durch die Nicht-Beachtung von noch ziemlich lebendigen Weggefährtinnen – totschweigen nennt man das wohl. Am Ende spricht er dann noch über sein aktuelles Projekt, das unter dem Arbeitstitel Arriver à Paris die Fortsetzung von Retour à Reims erzählen wird. So hatte es auch Édouard Louis bereits gemacht, als er 2021 mit Changer: méthode die Fortsetzung von En finir avec Eddy Bellegueule (2014) auf den Markt brachte. Das Karussell wird sich also weiterdrehen…
Sociobiographie wird ganz sicher auch demnächst in deutscher Übersetzung erscheinen. Wer sollte es lesen? Ich versuche es mal mit einem Vergleich aus der Popmusik: Wenn Popstars einige mehr oder minder erfolgreiche Alben auf dem Markt hatten, bringen sie irgendwann das obligatorische Best-Of raus, eine Kompilation ihrer größten Hits. Für Fans, die bereits sämtliche Vorgänger-Alben zuhause haben (sorry, ich denke immer noch in analogen Dimensionen), ist dieses Best-Of eher langweilig und verzichtbar, da man ja alles schon kennt. Für diejenigen aber, die die älteren Hits ganz gut fanden, aber nie ein ganzes Album kaufen mochten, ist eine solche Kompilation ein willkommenes Schnäppchen. In etwa so verhält es sich mit Sociobiographie. Manchmal aber bieten Greatest Hits neben den alten Erfolgen auch noch einen unveröffentlichten Track, der dann auch die hartgesottenen Fans doch noch zum Kauf animieren soll. Dies tut auch Eribon, indem er dem Interview noch einen Epilog folgen lässt, in dem er von seiner Opernliebe berichtet. Diese elf Seiten sind tatsächlich die schönsten des Buchs, da hier ein Liebhaber über Musik schreibt und zugleich – aufgrund seiner sozialen Herkunft – ein unwahrscheinlicher Liebhaber, gilt doch die Oper gemeinhin als Popmusik des Bildungsbürgertums, dem Eribon nun einmal bekanntlich nicht von Geburt an angehörte. Möglicherweise ist dieser Bonustrack aber nur ein kleiner Vorgeschmack auf das nächste Album, das ja, wie wir nun wissen, bereits in der Pipeline steckt.
Didier Eribon: Sociobiographie. Entretien avec Geoffroy Huard, 2025, Paris: Flammarion, 336S.
Weitere interessante Beiträge
Kamel Daouds mit dem Prix Goncourt ausgezeichneter Roman 'Houris'

Daniel Winkler
Simon Chevrier gewinnt verdient mit 'Photo sur demande' den Prix Goncourt du premier roman.

Gregor Schuhen
In Jérôme Leroys 'La Petite Gauloise' finden fast ebenso viele Morde statt wie die Erzählung Seiten hat


