Den algerischen Bürgerkrieg sinnlich erzählen und stimmlich erinnern
Kamel Daouds mit dem Prix Goncourt ausgezeichneter Roman 'Houris'


Daniel Winkler

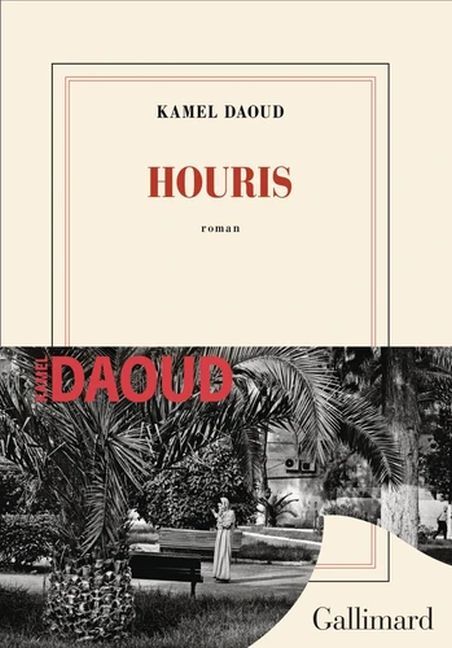
Auch wenn der algerische Unabhängigkeitskrieg (1954-62) und der Bürgerkrieg (1991-2002) literarisch ganz unterschiedlich aufgearbeitet worden sind, so liegen doch auch eine ganze Reihe von Romanen vor, die das so genannte 'schwarze Jahrzehnt' literarisiert haben. Zu den Autoren und Autorinnen zählen Maïssa Bey, Aïssa Khellad, Boualem Sansal oder ganz rezent Kaouther Adimi. Kamel Daoud erwähnt das zwar nicht, greift aber mit seinem neuen Roman Houris (Gallimard 2024), der mit dem prestigereichen Prix Goncourt ausgezeichnet wurde, darauf zurück. Ende August ist er in der Übersetzung von Holger Fock und Sabine Müller unter dem Titel Huris in dem Berliner Verlag Matthes & Seitz erschienen. Als Chefredakteur beim Quotidien d’Oran und Kolumnist bei diversen europäischen Organen wie Le Point und Die Welt hat sich Daoud vielfach kritisch mit dem nationalen Unabhängigkeitskrieg gegen Frankreich auseinandergesetzt. So in den frühen noch in Algerien verlegten Kurzgeschichten, die auf Deutsch von Lisette Buchholz im persona-Verlag unter dem Titel Minotaurus 504 (2012) publiziert wurden, wobei es sich um die erste Daoud-Übersetzung ins Deutsche handelt. Mit seiner Kritik am Fundamentalismus, aber auch an naiven europäischen Blickweisen auf Algerien, hat er sich nicht nur Freunde gemacht. Er wurde in Algerien mit zwei Fatwas belegt, ist 2023 nach Frankreich emigriert und auch sein neuer Roman – in Algerien verboten – hat hier wie dort Polemiken und Klagen ausgelöst.
Huris widmet sich in einer eindringlichen Metaphorik dem algerischen Bürgerkrieg als ‚vergessenem‘ Krieg. Den Fokus richtet Daoud dabei auf das gesetzliche Verbot, den Krieg ‚staatsschädigend‘ zu thematisieren, sowie auf die zivilen Opfer des islamistischen Terrorismus, die vermutlich in die Hundertausenden gehen. Mit der stummen und schwangeren Protagonistin Aube rückt er vor allem die Frauen als Opfer von Krieg und Fundamentalismus ins Zentrum. Aus dem nordalgerischen Dorf Had Chekala stammend, wurde ihr im Alter von fünf Jahren bei einem islamistischen Massaker, das nur sie überlebt hat, die Kehle durchschnitten. Die Rettung erfolgte durch die Hilfe ihrer späteren Adoptivmutter Khadija, die sie nach Oran gebracht hat und die bis in die Gegenwart die Hoffnung nicht aufgibt, Aubes zerstörte Stimmbänder wiederherstellen zu lassen. Doch Aube hat ihren Geschmacks- und Geruchssinn für immer verloren und kann nur noch Laute von sich geben.
Diese Einschränkung macht Daoud zum poetischen Atout, d.h. zum Konstruktionsprinzip seines vielstimmigen Romans, dessen Handlungszeit in etwa der Schwangerschaft Aubes entspricht. Er strukturiert Huris in Monologe verschiedener Figuren aus unterschiedlichen Schichten und Regionen. Der Roman besteht dabei aus drei großen Teilen, die mit den Titeln Stimme, Labyrinth und Messer überschrieben sind und je gut 30 Kapitel enthalten. Den größten Anteil davon nimmt Aubes innerer Monolog ein, den sie mit ihrem Fötus führt, der auf eine Strandbekanntschaft mit einem Fischer zurückgeht. Ergänzt wird Aubes Rede vor allem durch den Monolog des Taxifahrers Aïssa, der aus einer traditionsreichen Buchhändlerfamilie aus dem nordostalgerischen Batna stammt. Als ihre Spiegelfigur kann er zwar sprechen, aber nicht schreiben. So hält er der stummen Aube einen Monolog, in dem er sein Memorierungs- und Erzähltalent anhand beeindruckender wie traumatisierender Details des Bürgerkriegs entfaltet. Ist ihm das öffentliche Erzählen verboten, so sind für ihn Aube und ihre breite Narbe am Hals, die sie selbst als Grinsen bezeichnet, Beweis für den Krieg und damit auch dafür, dass seine Geschichten wahr und nicht imaginiert sind.
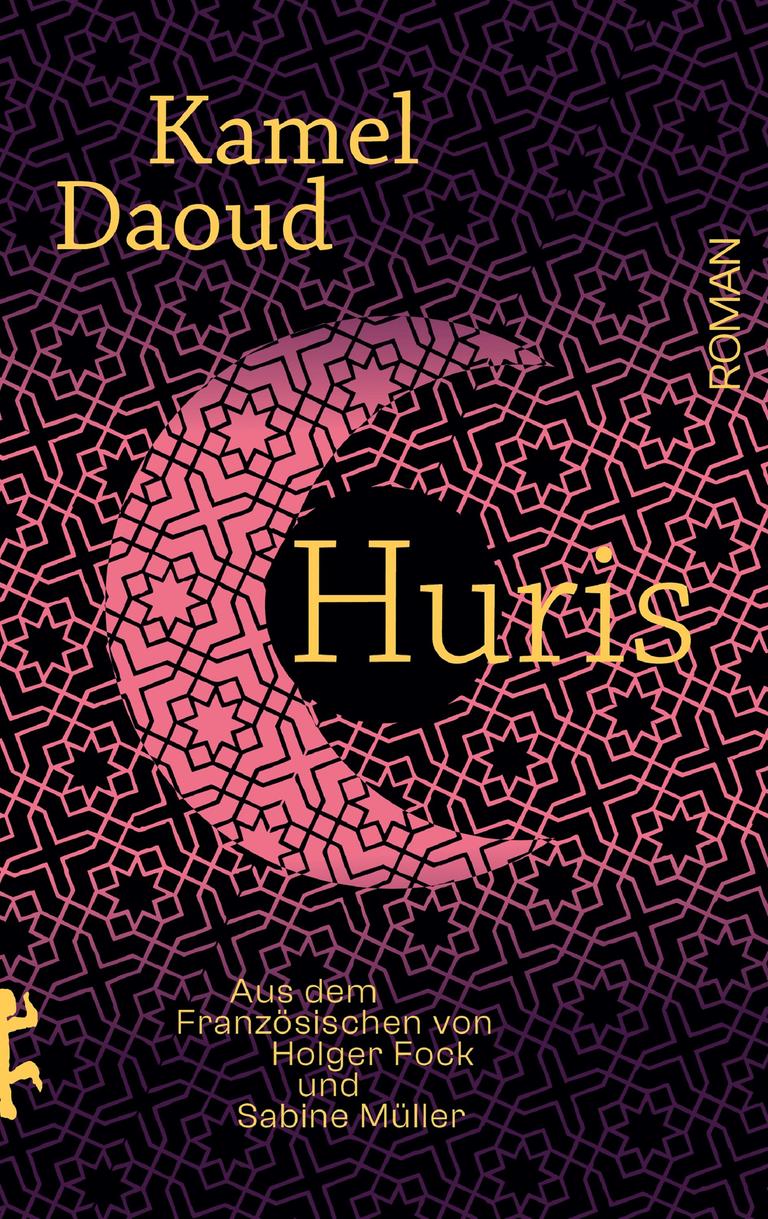
Auf diese Weise entwickelt Daoud aus den Einschränkungen und Traumata der Figuren Stärken. Der Name Aube, auf Deutsch Morgendämmerung, den die Protagonistin für ihr ‚zweites‘ Leben erhält, und ihre dem Schönen gewidmete Profession als Besitzerin des Oraneser Friseursalons Shéhérazade stehen für eine sinnlich-emanzipatorische Erinnerungsarbeit. Aube wird so zur Antagonistin des Imams der ihrem Salon gegenüberliegenden Moschee, aber auch genereller zum Inbegriff einer mutigen Antiislamistin. Daouds Roman verflicht so das Politische, das Alltägliche und das Poetische im Spannungsfeld von Dokumentieren und Imaginieren, Erinnern und Schweigen. Daoud entwickelt damit eine politische Poetik des Mediterranen, die in einer Bilderwelt plastisch wird, die das sinnliche mündliche Erzählen selbst zum Thema macht, inklusive der mit ihm verbundenen Traditionen, Wiederholungsstrukturen, Flüchtig- und Mehrdeutigkeiten.
Ganz in diesem Sinn greift schon der Romantitel die schönen weißen Jungfrauen auf, die dem Koran zufolge auf die toten Seelen im Paradies warten, und deutet sie laizistisch und emanzipatorisch um. Die Jungfrauen korrelieren mit der Protagonistin Aube, die ihren Fötus, den sie angesichts der politischen Verhältnisse abtreiben will, süffisant Huri nennt. Doch der Plural Huris verweist auch auf die Vielstimmigkeit des Romans selbst, der unterschiedliche Opferperspektiven auf den Bürgerkrieg vereint. Das mehrdeutige Erzählen vom Bürgerkrieg erweist sich so angesichts des Status quo in Algerien als einzige Möglichkeit für die beiden Protagonist:innen, sich mit dem in Had Chekala Geschehenen zu konfrontieren und ein sinnlich-mediterranes Lebensglück wiederherzustellen. Entsprechend nennt sie ihr Neugeborenes nicht nach den koranischen Jungfrauen Huri, sondern nach der ägyptischen Diva Oum Kalthoum (1904-75), Inbegriff weltlich-sinnlicher Sangeskunst.
So fasst Daoud das mündliche Erzählen in Huris als Verführen: Das Geschehene wird über unterschiedliche Stimmen, Herkünfte und Verhältnisse sinnlich erinnert, kann aber nie ganz die Angst vertreiben, dass das Erzählte ohne schriftliche Fixierung verpufft. Der Roman macht so als poetisches Dokument gegen das Vergessen deutlich, dass der algerische Bürgerkrieg nur in Form einer heterogen-pluralen Anlage von Geschichten erzählt werden kann. Denn angesichts des Geschehenen gibt es weder ein Zurück zu einer körperlich-seelischen Integrität noch zu einer romanesken Einstimmigkeit.
Kamel Daoud: Houris, 2024, Paris: Gallimard, 411S.
Kamel Daoud: Houris, 2025, übers. v. Holger Fock u. Sabine Müller, Berlin: Matthes & Seitz, 398S.
Weitere interessante Beiträge
Im Interviewband 'Sociobiographie' (2025) legt der französische Intellektuelle eine eigene Werkschau vor

Gregor Schuhen
Simon Chevrier gewinnt verdient mit 'Photo sur demande' den Prix Goncourt du premier roman.

Gregor Schuhen
In Jérôme Leroys 'La Petite Gauloise' finden fast ebenso viele Morde statt wie die Erzählung Seiten hat


